Mitte Juni trafen sich auf Einladung der Ernährungsräte des Landes NRW und dem Landesverband Regionalbewegung NRW rund 40 Vertreter aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft in Düsseldorf, so der Landesverband Regionalbewegung NRW e.V.
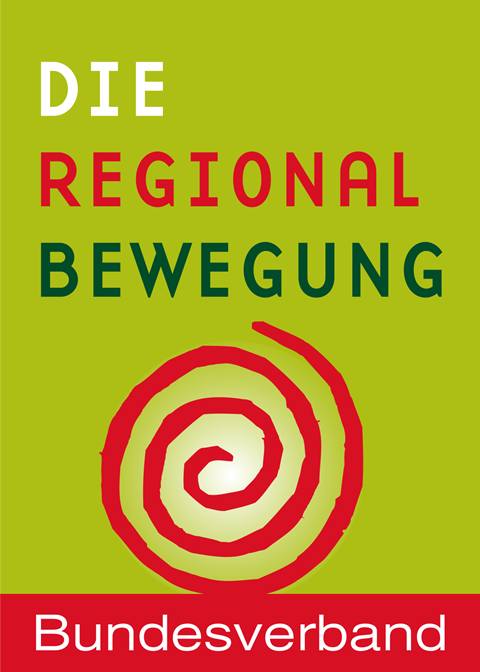
Das Ergebnis des facettenreichen REGIOtalks, der im Rahmen des von der Stiftung Umwelt und Entwicklung geförderten Projektes Regio.Diskurs.NRW stattfand, war eindeutig: eine regionale ErnährungsWIRTSCHAFT braucht Kümmerer und belastbare Zahlen um die guten Lösungen, die es schon gibt aus den Nischen heraus zu führen – dafür braucht es unbedingt „klinkenputzende“ Wertschöpfungskettenmanager.
Den ersten Impuls des Nachmittages lieferte der Inhaber der Humboldt-Professur für Nachhaltige Ernährungswirtschaft in Freiburg, Prof. Dr. Arnim Wiek. In seinem Vortrag gelang es ihm eindrucksvoll darzustellen, dass die Politik eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung eines nachhaltigen ErnährungsWIRTSCHAFTssystems spielt. Er plädierte für eine aktive Gestaltung der ErnährungsWIRTSCHAFTsswende und lenkte den Blick darauf, dass neben den bekannten Kosten, die das aktuelle System für die Umwelt und Ausbeutung entlang der Lieferkette verursacht, besonders der Umsatzrückgang in der Regionalwirtschaft erhebliche Kosten für die Gesellschaft verursacht.
Lösungen für mehr Nachhaltigkeit sieht er in Innovationen, die jenseits der Marktlogik mehr Solidarität und Bindung von Konsumenten erzeugen (wie solidarische Modelle und eine regionale Außerhausverpflegung), einer innovativen Dezentralisierung in Produktion und Handel (die bestehende Strukturen nutzt, um regionale Wertschöpfungszentren aufzubauen), sowie einer Regionalisierung von Wertschöpfung durch gezielte Investitionen.
Zielgerichtete Subventionen und Förderinstrumente könnten aus seiner Sicht die Entwicklung eines krisenfesten ErnährungsWIRTSCHAFTssystems unterstützen, was dann auch Ernährungssicherheit und gute Gesundheit, sowie eine stabile, starke Regionalwirtschaft, die dann auch ihren Beitrag zur öffentlichen Daseinsvorsorge liefert, fördert.
Er rief dazu auf, schon bestehende Beispiele für erfolgreich regionalisierte Wertschöpfungsketten zu sammeln und als Best Practice verfügbar zu machen und verwies auf eine schon vorhandene Sammlung von Instrumenten, die als Forschungsergebnisse schon zur Verfügung stehen.
Mathias Johnen von der DEHOGA Nordrhein e.V. und Markus Pfeifer von der Regionalmarke EIFEL GmbH flankierten die Aussagen aus der Wissenschaft mit Erfahrungen und Einschätzungen aus ihrer Praxis.
Pfeifer brachte dabei konkrete Forderungen mit. Für ihn muss Regionalität klar definiert und überprüfbar sein. Da entsprechende Kontrollmechanismen nicht zum Nulltarif zu haben sind, brachte er als ein mögliches Finanzierungsinstrument für Regionalinitiativen einen „Regionalitäts-Cent“ ins Gespräch. Auch betonte er die Notwendigkeit von regionalen und neutral finanzierten Ansprechpartnern, die als „Lotsen“ Hilfe und Unterstützung bei den vielfältigen und komplexen Themen rund um regionale Wertschöpfungsketten bereitstellen sollten.
Johnen betonte die Notwendigkeit von lokalen Großmärkten für die regionale Lebensmittelversorgung. Er spricht sich für mehr Wertschätzung entlang der Wertschöpfungsketten aus und sieht ebenso die Notwendigkeit von regional agierenden Wertschöpfungskettenmanager, bei denen die Fäden der regionalen Ernährungswirtschaft zusammenlaufen – auch um neuartige Lösungen im Markt testen zu können.
Brigitte Hilcher vom Landesverband Regionalbewegung NRW griff die Argumente ihrer Vorredner auf und betonte die Querschnittsaufgabe, die der ErnährungsWIRTSCHAFT für die Transformation des Ernährungssystems, insbesondere auch in Hinblick auf den Klimaschutz zukommt. Aus Sicht der Regionalbewegung sollten Kommunen befähigt werden, die Nahversorgungsstrukturen als Kernbereich ihrer regionalen Daseinsvorsorge zu stärken und zu unterstützen.
„Ernährung wird aktuell vorwiegend von Seiten des Landwirtschaftsministeriums adressiert – was aber für den Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten – vom Acker über die Verarbeitung auf den Teller nicht ausreicht“, analysiert sie den Status-Quo. „Nachhaltige Prozesse müssen auf allen Ebenen der ErnährungsWIRTSCHAFT entwickelt werden und betreffen die Landwirtschaft genauso wie die Wirtschaft – doch um Beides zusammen zu denken braucht es Instrumente, die eine Regionalisierung in der Ernährungswirtschaft voranbringen – hier könnte die Einrichtung von regionalen Wertschöpfungszentren als Modellvorhaben ein Schritt in die richtige Richtung sein“, bringt sie die Ergebnisse der von der Regionalbewegung veröffentlichten Regionalitätsstrategie NRW auf den Punkt und merkt an, dass bereits erste Gespräche zur Bildung einer interministeriellen Task-Force zwischen dem Wirtschafts- und dem Landwirtschaftsministerium geführt wurden.
Für den Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten sei es wichtig, bestehende Strukturen zu nutzen, die vielfältigen Aktivitäten in den Regionen zum Aufbau regionaler Wertschöpfungsnetzwerke zu koordinieren und alles in einer übergreifenden und nachhaltigen Ernährungsstrategie zu verankern. Die Mitarbeit an diesen Ernährungsstrategien haben sich auch die neu gegründeten Ernährungsräte des Landes NRW auf die Fahnen geschrieben. Sie setzen sich mit Leidenschaft für eine zukunftsfähige und gesunde Ernährung in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus ein. Dabei sei es ihnen ein zentrales Anliegen, die Weichen für eine nachhaltige und gerechte Ernährungspolitik zu stellen, die sowohl die Gesundheit der Menschen als auch die Umwelt berücksichtige.
Dr. Barbara Steinrück, Ulla Tenberge-Weber und Karin Schmidt betonten in ihrem Vortrag, wie wichtig ein Miteinander entlang der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette sei: „Wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass die Landwirtschaft, Bildung zu Ernährung und die Ernährungswirtschaft zu allen 17 SDG beitragen - hier bei uns in NRW und natürlich auch im globalen Kontext“. Um den Prozess hin zu einer Ernährungsstrategie für das Land mitzugestalten, wünschen sie sich ein Netzwerk und ein Miteinander aller Akteurinnen und Akteure entlang der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette, um gemeinsam die Weichen für Ernährungssicherheit und ein nachhaltiges Ernährungssystem zu stellen. Ernährung ist ein wichtiges Thema für den Klimaschutz, das in den Nachhaltigkeitsstrategien der Kommunen zwingend mitgedacht werden sollte. Das Feedback aus der Politik auf die Arbeit der Ernährungsräte erleben die drei Rednerinnen als sehr positiv und laden zum weiteren Dialog ein.
Nach den Vorträgen waren alle Teilnehmenden eingeladen, sich an einer Fish-Bowl-Diskussion mit ihren Fragen, ihrer Expertise, ihren Sichtweisen und ihren Impulsen zu beteiligen. Es herrschte Einigkeit, dass die Regionalisierung der Ernährungswirtschaft der richtige Weg sei. Es sei aber auch ein Weg, der Kontakte und Beziehungen brauche – mit dem Ziel, ein gemeinsames Verständnis für die ErnährungsWIRTSCHAFT der Zukunft zu schaffen. „Wir müssen mit unseren Themen die Menschen erreichen, das Thema positiv besetzen und den wirtschaftlichen Benefit betonen“, bringt es Pia Weselowski, Nachhaltigkeitscoach der DEHOGA NRW auf den Punkt. Sumaya Islam vom Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland (SEND) sieht in dem Thema ein großes Potential für nachhaltige Start-Ups.



